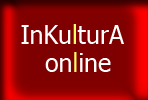Buchkritik -- Dieter Thomä -- Post-: Nachruf auf eine Vorsilbe
 Die Geistes- und Sozialwissenschaften der letzten Jahrzehnte sind durch eine eigentümliche Sprachfigur geprägt: das „Post‟. Ob Postmoderne, Postkolonialismus, Postdemokratie oder Posthumanismus, stets scheint ein Nachdenken nach dem Ende, ein Denken im Modus des Danach zu geschehen. Der Philosoph Dieter Thomä widmet dieser Vorsilbe mit seinem Buch „Post. Nachruf auf eine Vorsilbe‟ einen scharfsinnigen Essay, der zugleich Diagnose, Kritik und Appell ist.
Die Geistes- und Sozialwissenschaften der letzten Jahrzehnte sind durch eine eigentümliche Sprachfigur geprägt: das „Post‟. Ob Postmoderne, Postkolonialismus, Postdemokratie oder Posthumanismus, stets scheint ein Nachdenken nach dem Ende, ein Denken im Modus des Danach zu geschehen. Der Philosoph Dieter Thomä widmet dieser Vorsilbe mit seinem Buch „Post. Nachruf auf eine Vorsilbe‟ einen scharfsinnigen Essay, der zugleich Diagnose, Kritik und Appell ist.
Thomäs Grundthese ist ebenso einfach wie provokant: Das „Post‟ suggeriere Aufbruch, stehe aber tatsächlich für eine geistige Selbstlähmung. Die Vorsilbe inszeniere einen Bruch mit der Vergangenheit, ohne diesen wirklich zu vollziehen. Stattdessen werde das Vergangene lediglich zur leeren Kulisse einer scheinbar neuen Epoche, in der das Alte fortlebt, während das Neue ausbleibt. So verlängere sich das Denken der Moderne unter dem Deckmantel ihres Endes.
Dabei analysiert Thomä drei prominente „Postismen‟: die Postgeschichte, die Postmoderne und den Postkolonialismus. In jedem dieser Fälle zeigt sich, wie das „Post‟ einen ambivalenten Status markiert, zwischen Abgrenzung und Abhängigkeit, zwischen Dekonstruktion und Fortsetzung. So werde etwa der Postkolonialismus zwar als Kritik kolonialer Machtverhältnisse verstanden, trage aber deren Denkfiguren oft unreflektiert weiter.
Thomäs Kritik ist keine bloße Polemik. Er geht den historischen und diskursiven Spuren der Vorsilbe nach, analysiert deren rhetorische und erkenntnistheoretische Funktion. Dabei entfaltet sich sein Essay als ein Plädoyer für Geistesgegenwart: Statt uns im Modus des „Post‟ der Vergangenheit zu unterwerfen, sollten wir uns dem Denken im Hier und Jetzt zuwenden. Geistesgegenwart heißt für Thomä, eine Haltung zu entwickeln, die Gegenwart nicht als bloßes Danach begreift, sondern als offenen Raum der Möglichkeit.
Stilistisch gelingt Thomä eine Balance zwischen philosophischer Tiefe und essayistischer Eleganz. Seine Argumente sind sorgfältig entwickelt, seine Sprache klar und pointiert. Er zitiert kenntnisreich, nimmt seine Leserinnen und Leser mit durch die Windungen philosophischer Debatten, ohne dabei in akademische Selbstbezogenheit zu verfallen. Gleichwohl verlangt die argumentative Dichte Konzentration und eine gewisse geisteswissenschaftliche Vertrautheit. Wer jedoch bereit ist, sich auf Thomäs Denkbewegungen einzulassen, wird mit vielen Aha-Momenten belohnt.
Besonders bestechend ist Thomäs Blick für die rhetorischen Strategien intellektueller Moden. Er entlarvt das „Post‟ als eine Geste, die sich, vermeintlich kritisch, doch oft im Bestehenden verheddert. Der Anspruch, mit der Vergangenheit zu brechen, gerät dabei zur Selbstversicherung des eigenen theoretischen Habitus. Diese Beobachtung führt zu der weiterreichenden Frage, ob und wie zeitgenössisches Denken sich überhaupt noch der Zukunft zuwenden kann, ohne dabei in den Fesseln vergangener Deutungsmuster zu verharren.
Gleichwohl bleibt ein gewisser Vorbehalt: In seiner Kritik an der „Post‟-Denkweise droht Thomä gelegentlich selbst zu generalisieren. Nicht jeder PostBegriff ist bloße Rhetorik, manche leisten genuine theoretische Innovationsarbeit. So könnte man dem Postkolonialismus etwa zugutehalten, dass er epistemische Gewalt sichtbar gemacht und neue Perspektiven auf globale Machtverhältnisse eröffnet hat. Hier hätte eine differenziertere Betrachtung dem Text gutgetan und Thomäs Argumentation noch überzeugender gemacht.
Unterm Strich ist Post ein kluges, streitbares Buch, das die Sprach- und Denkmuster unserer Zeit aufs Korn nimmt. Es bietet nicht nur eine originelle Analyse einer überstrapazierten Vorsilbe, sondern auch eine Einladung, sich vom intellektuellen Schatten der Vergangenheit zu emanzipieren. In einer akademischen Landschaft, die oft von Konzeptmoden durchzogen ist, wirkt Thomäs Essay wie ein Weckruf zur Begriffsnüchternheit und gedanklichen Eigenständigkeit. Wer sich für Philosophie, Kulturkritik und die Zukunft des Denkens interessiert, wird bei Thomä fündig, und womöglich selbst mit dem „Post‟ ins Gericht gehen.
Meine Bewertung:
Veröffentlicht am 14. Juni 2025